Von Michelle Bendicks
im Rahmen des Master-Moduls "Project International"
„This is Radio Sagarmatha“: Raghu Mainali erinnert sich genau an den einen Moment zurück, der nicht nur sein Leben und seine Karriere, sondern auch den Hörfunk in Nepal für immer verändert hat. Mit Radio Sagarmatha ging in 1997 der erste Communitysender Nepals on air – eine Art, Radio zu produzieren, die das Land bis heute prägt.

Der nepalesische Journalist Raghu Mainali hat mich zu sich in die Universität eingeladen. Hier forscht er an medialen Entwicklungen des Himalayastaates und gibt seine Hörfunk-Expertise an junge Student_innen weiter. Mit fast 30 Grad draußen ist es in der prallen Sonne für mich kaum aushaltbar, aber zu einem heißen, traditionellen Milchtee sage ich dennoch nicht nein. Nachdem wir an einem der wackeligen Tische in der lauten Mensa Platz genommen haben, nimmt mich der Journalist mit auf eine Reise in die Vergangenheit.
In einem Land vor meiner Zeit
Raghu Mainali erinnert sich an die Zeit zurück, in der die Medienlandschaft Nepals stark von Zensur und staatlicher Kontrolle geprägt war. Bis 1990, unter dem Regime der Panchayat-Regierung, gab es nur eine begrenzte Anzahl von Medien: So war Radio Nepal, als Sprachrohr der Regierung, die einzige Radiostation des Landes. Nach dem Ende des Panchayat-Regimes entstanden zahlreiche unabhängige Medien, die eine vielfältigere Berichterstattung sicherten.
Zu ihnen zählt auch das knapp sieben Jahre später, durch Mainali und Unterstützer wie dem Nepal Forum of Environmental Journalists (NEFEJ), gegründete Radio Sagarmatha: Es ist das erste Communityradio Nepals. Mit diesem neuen Radioformat wollte der Journalist ein Radio für alle schaffen und Zuhörer_innen mit Nahbarkeit begeistern: „In den traditionellen Medien, besonders im Zeitungsjournalismus, geben Journalist_innen oft an, die Stimme der Stimmlosen zu sein. Doch in Wahrheit werden immer nur die Meinungen und Interessen politischer oder großer wirtschaftlicher Akteure dargestellt.“ Mit dem Prinzip des Community-Radios sollte sich genau das ändern: Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten sollten die Möglichkeit erhalten, ihre Geschichten im Radio zu erzählen und so im Hörfunk niedrigschwellig zu partizipieren. „Wirklich jede und jeder kann eine eigene Show im Communityradio moderieren. Das Resultat ist ein buntgemischtes Programm, das dennoch strukturiert ist. Seine Besonderheit liegt in der Vielfalt: Durch die hohe Partizipation ist das Programm jedes Senders sehr individuell und auf die einzelnen Dörfer zugeschnitten.“ Neben persönlichen Geschichten und Erlebnissen läuft in den Communityradios viel lokale Musik, berichtet Mainali. Er erklärt, dass diese auch immer mal wieder vor Ort eingesungen oder eingespielt und dann live veröffentlich wird.
Ich bin beeindruckt von dieser Partizipation und dem Mut, den die Bürger_innen beweisen. Ich denke an das deutsche Bürgerradio und frage mich, wieso dieses (unter anderem) aufgrund mangelnder öffentlicher Beteiligung auszusterben scheint. Ich teile meine Gedanken mit Mainali – der Journalist wirkt entsetzt. „In Nepal ist Radio oft die einzige Chance für gewöhnliche Bürger, Einfluss zu nehmen und an ihrer Situation etwas zu ändern. Dadurch, dass die Menschen nicht mal ihr Gesicht, sondern nur ihre Stimme zeigen müssen, ist es zudem sehr niedrigschwellig und die Beteiligung entsprechend hoch.“ Dass dies in anderen Ländern anders zu sein scheint, erklärt er sich mit unterschiedlichen Mediensystemen, stark variablen geografischen, wirtschaftlichen und strukturellen Voraussetzungen.
„Die Regierung verbot das Senden von Nachrichten, wir durften nur noch Musik spielen. Also sangen wir kurzerhand die Nachrichten.“
Gemeinsam gegen den König
Die Bereitstellung eines solchen Sprachrohrs für die Bürger_innen war immer eines der Hauptziele Mainalis. „Die Hauptsache war, dass Radio Sagarmatha live ist und wir andere damit inspirieren können – egal ob wir die Lizenz nicht hatten oder ob es Verbote durch die Regierung gab.“ Ich stutze und bitte ihn, mir mehr davon zu erzählen. Der Journalist grinst. Er erzählt mir von den ersten Jahren nach der Gründung. „Nachdem wir von der UNESCO unseren Radiotransmitter erhielten, wollten wir mit der Übertragung beginnen. Auf unsere Versuche, eine Sendelizenz zu erhalten, erhielten wir keine Antwort. Ich schrieb etliche Briefe an entsprechende Stellen in der Regierung, doch nie kam etwas zurück. Also gingen wir ohne Lizenz auf Sendung.“ Jahre später erhalten sie die offizielle Berechtigung, kommen ohne größere Strafen um die vorige Zeit herum, wie Mainali erzählt. Dies sollte jedoch nicht der einzige Kampf sein, den die Mitarbeitenden Sagarmathas erlebten: Im Jahr 2005 wird die Presse des Landes unter eine königliche Zensur gestellt. Besonders die privaten Radiosender leiden unter strikten Einschränkungen, so wird Radio Sagarmatha zwei Tage lang durch die Behörden geschlossen und unter Beobachtung der Polizei gestellt. „Wir wussten, dass wir uns nicht unterkriegen lassen durften. Wir wussten, wir müssen für die Freiheit – und besonders die Pressefreiheit des Landes kämpfen. Wir organisierten viele verschiedene, friedliche Proteste um gegen die Zensur vorzugehen. Zu unserem Glück schlossen sich uns dabei viele weitere Radiostationen an.“ Um die Auflagen der Regierung zu erfüllen und trotzdem die Bevölkerung zu informieren, ließen sich die JournalistInnen immer wieder neue Möglichkeiten einfallen. „Die Regierung verbot das Senden von Nachrichten, wir durften nur noch Musik spielen. Also sangen wir kurzerhand die Nachrichten“, erinnert sich Manali lachend.
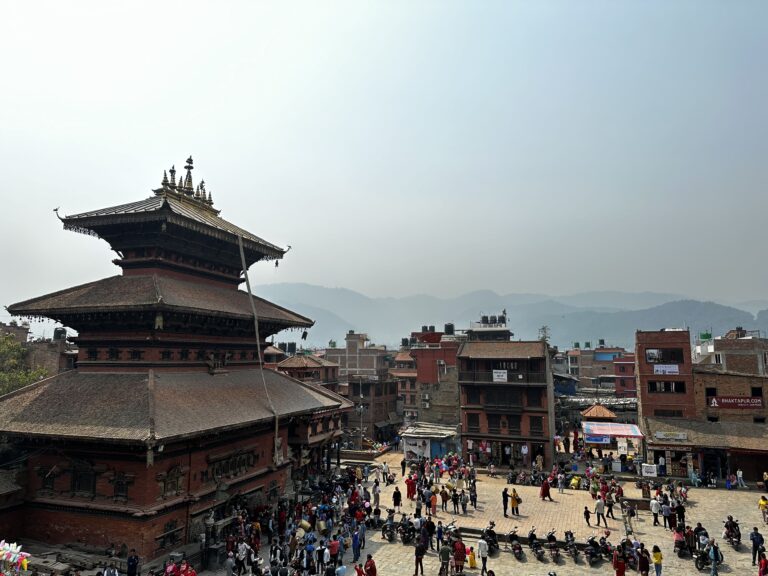
Es ist ein Abschluss, der mich wahnsinnig inspiriert und ehrfürchtig zurücklässt. Auf dem Rückweg hole ich meine Kopfhörer heraus und schalte den Livestream von Radio Sagarmatha ein. Auch wenn ich nichts verstehe – ich fühle mich nach diesem besonderen Nachmittag mit ihrem Inhalt und ihrer Geschichte verbunden.
