Über die Expertin
Professorin Dr. med. Sabine Oertelt-Prigione
Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und hat sich auf geschlechtersensible Medizin und öffentliche Gesundheit spezialisiert. Frau Oertelt-Prigione hat eine Professur am Radboud University Medical Center und an der Universität Bielefeld inne, wo sie die Arbeitsgruppe für geschlechtersensible Medizin an der neu gegründeten Medizinischen Fakultät OWL aufbaut. Vorher arbeitete sie am Berliner Institut für Geschlechterforschung und am Institut für Rechtsmedizin der Charite als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie ist 43 Jahre alt und beschäftigt sich seit 15 Jahren mit dem Themengebiet der geschlechtersensiblen Medizin.
Werden alle Geschlechter medizinisch gleichberechtigt behandelt?
Leider nicht. Dieser Herausforderung stellt sich die Geschlechtersensible Medizin (GSM). Warum diese in einem ganz eigenen Emanzipationsvorgang steckt und Frauen sowie Männer gleichwertig etwas angeht, erklärt Professorin Dr. med. Sabine Oertelt-Prigione.
Budde: Wie lange gibt es die Geschlechtersensible Medizin (GSM) schon?
Oertelt-Prigione: Die rein geschlechtersensible Medizin gibt es seit den 1990er Jahren. Damals wurde erkannt, dass kardiovaskuläre Erkrankungen unterschiedliche Symptome haben und auch Frauen daran erkranken können. Vorher wurde gedacht, dass sie bis zur Menopause einigermaßen geschützt wären. Die Frauengesundheitsbewegung in den 1970er Jahren war der Vorreiter – ohne diese hätte es wahrscheinlich keine Geschlechtersensible Medizin gegeben. Die Ansätze sind jedoch unterschiedlich: In der Frauengesundheitsbewegung ging es allein um die Frauen, da es im Bereich der Medizin nicht viele Informationen dazu gab. Es war sehr auf die weibliche Reproduktion bzw. Verhütung bezogen.
Was macht die GSM aus?
Es geht darum alle Geschlechter zu untersuchen und durch den Vergleich der unterschiedlichen Symptome, Ausprägungen und Entstehungen von Erkrankungen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die letztendlich allen zu Gute kommen. Warum ist es notwendig, dass die GSM in Medizin, Forschung und Praxis übernommen wird? Es besteht das Problem, dass Frauen bei Arzneimittelgebrauch häufiger Nebenwirkungen haben als Männer. Zum Teil können dies schwerwiegende Nebenwirkungen sein. Zum Beispiel sehen wir es momentan mit den COVID-19-Vakzinen, wie es mit dem Thromboserisiko aussieht. Dass Frauen bei den meisten Arzneimitteln mehr Nebenwirkungen haben, kann zum Beispiel eine relative Überdosierung sein. Ein weiterer Faktor ist die Verarbeitung von Arzneimitteln im Körper, die unterschiedlich funktioniert. Es kann auch sein, dass Frauen Nebenwirkungen häufiger berichten als Männer. Insgesamt führt es dazu, dass bei Frauen viel mehr Nebenwirkungen registriert werden. Es kann vom Ausschlag oder Übelkeit bis hin zu einem Herzinfarkt gehen. Und um diese zu erkennen und voraus zu sehen, ist es wichtig in der Planung von Studien und in der Untersuchung und Analyse der Ergebnisse der Studien diese Geschlechtsspezifik mitzunehmen. Und dann haben wir natürlich noch ganz andere Faktoren, bei denen auch Gender, das soziale Geschlecht, eine Rolle spielt. Eben wenn es um den Zugriff auf die Gesundheitsleistungen geht, um zeitliche Diagnoseverschiebungen, weil man erwartet, dass eine Person mehr oder minder eine Erkrankung haben könnte. In diesem Zusammenhang geht es um eine individualisiertere Behandlung, aber auch darum Menschen so zu akzeptieren wie sie sind. Und die Tatsache anzuerkennen, dass es Abweichungen von der absoluten Norm gibt, die manchen Menschen noch vorschweben mag. Wir müssen diese Menschen trotzdem so gut wie möglich mit jeglichem Respekt behandeln. Und ihnen das Gefühl geben, dass sie all ihre Beschwerden äußern können, so dass wir eine bessere Therapie und Unterstützung anbieten können
Bei welchen Patientengruppen sind die Folgen der nicht vorhandenen Differenzierung am drastischsten? Sind nur Frauen benachteiligt oder auch Männer?
Es können alle Bevölkerungsgruppen und alle Geschlechter benachteiligt sein. Es hängt davon ab, wem wir stereotypische Erkrankungen zuordnen. Dazu gibt es ein paar stereotypische Beispiele: Historisch war es so, dass die kardiovaskulären Erkrankungen vor allem als männliche Erkrankungen gesehen und bei Frauen dementsprechend später, zum Teil nicht korrekt, diagnostiziert wurden. Das ist heute bei manchen Typen von kardiovaskulären Erkrankungen immer noch so. Osteoporose oder Autoimmunerkrankungen werden vor allem weiblich gesehen und daher wird bei Männern, im Fall der Osteoporose, kein Knochen-Screening gemacht. Oder die Diagnose wird bei Autoimmunerkrankungen später eingeleitet, weil man einfach nicht davon ausgeht, dass die Person eine Autoimmunerkrankung haben könnte. Auf der anderen Seite können Vorannahmen sinnvoll sein. Die werden im medizinischen Bereich gebraucht, wenn es um Akutfälle geht. Da hat man nicht die Zeit mit jemandem eine halbe Stunde zu sprechen. Heute sehen wir, dass viele Krankheiten eine unterschiedliche Symptomatik aufweisen, über die wir Einiges gelernt haben. Dieses Wissen ist jedoch nicht umfassend: Gewisse Symptome wurden im Medizinstudium so nicht gelehrt und in den Fachbüchern so nicht erwähnt. Dies erschwert eine Diagnose, weil gewisse Symptome nicht einer Erkrankung zugeordnet werden.
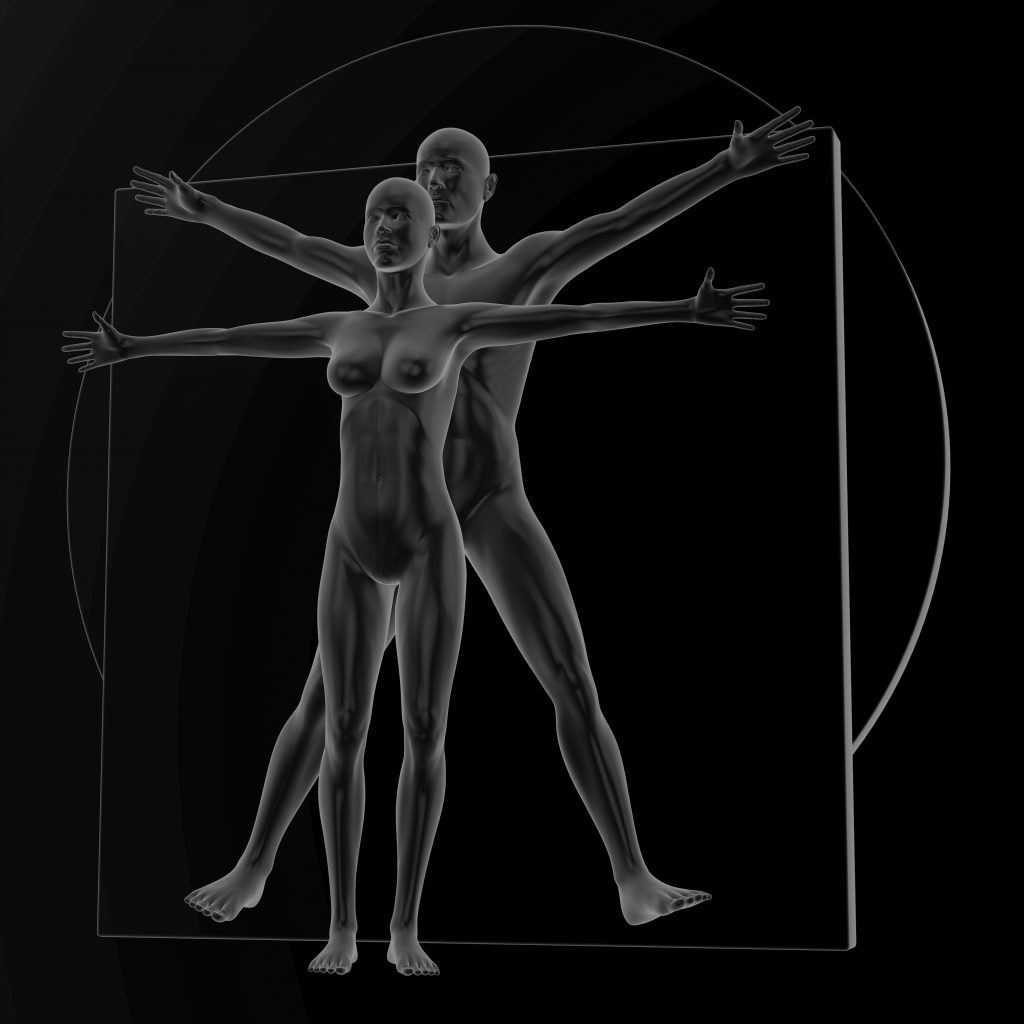

Wird die geschlechtersensible Medizin (GSM) im Medizinstudium behandelt oder ist es ein Spezialgebiet?
Wir haben das Ganze europaweit untersucht und Standard ist es insgesamt noch nicht. Bei den letzten Weiterentwicklungen der internationalen Lernzielkataloge wurde das Thema „Geschlechter- und Kultursensibel“ bei ganz vielen erwähnt. Aber inwiefern das die Realität des Studiums abbilden kann, ist noch unklar. Es ist auf jeden Fall institutionell gewünscht, aber definitiv nicht institutionalisiert. Es hat fast immer mit umfangreichen Veränderungen des Curriculums zu tun. Es ist sehr schwierig in ein bestehendes Curriculum plötzlich geschlechtersensible Inhalte zu integrieren bzw. diese als Querschnittskategorie durchzuziehen. Bei vielen Institutionen in Europa hängt es häufig davon ab, ob es eine aktive Gruppe in der Universität oder eine Professur dafür gibt. Es hängt sehr häufig von dem Engagement einzelner Personen ab.
Wie soll die GSM etabliert werden? Gibt es Weiterbildungen für Mediziner?
Es wurde vor Jahren mit der Bundesärztekammer versucht eine Zusatzweiterbildung zu etablieren. Das ist damals gescheitert. Es gibt immer wieder organisierte Fachveranstaltungen, aber kein strukturiertes Kurrikulum. Die Deutsche Gesellschaft für Geschlechtersensible Medizin hat die gesellschaftsspezifische Zusatzbezeichnung „Gendermediziner*in“ ins Leben gerufen. Für diese Zusatzbezeichnung muss man gewisse Schulungen besucht haben, um die inhaltliche Kompetenz vorweisen zu können.
Derartige Umschulungen basieren auf freiwilliger Basis. Gibt es rechtliche Vorgaben? Seit 2015 gibt es ein Präventionsgesetz, das auf die Notwendigkeit einer geschlechtersensiblen Medizin hinweist und auch darauf, dass die Kostenträger diese vergüten sollten. Es gäbe einen rechtlichen Rahmen dafür und jetzt geht es darum, wie man diesen pragmatisch ausfüllen kann. Die Kostenträger und die Politik sind in gewissem Maße daran interessiert und würden es ohne große Resistenz befürworten. Das Problem ist nur, dass wir dazu natürlich ein Konzept vorlegen müssen. Und da scheiden sich die Geister momentan noch. Das hat mit ganz vielen verschiedenen Ebenen zu tun. Es ist nicht nur eine Kultur- oder Systemveränderung, sondern eine Organisationsveränderung. Einerseits haben wir nicht all das Wissen, was wir bräuchten, um wirklich alle therapeutischen Leitlinien geschlechtersensibel zu entwickeln, weil die Daten zum Teil noch nicht ausreichend vorliegen. Auf der anderen Seite gibt es nur bedingt Finanzierung um große Studien geschlechtsspezifisch anzulegen um diese Daten zu erarbeiten. Warum ist der Begriff Gender Medizin unpassend? Es ist auch ein sprachliches Problem: Ich rede bewusst von geschlechtersensibler Medizin, weil das Thema Gender Medizin oft falsch verstanden wird. Es geht ja nicht nur um Gender. Zumindest in der Arbeit, die wir machen, und in der Medizin insgesamt geht es zu 80 bis 90 Prozent um das biologische Geschlecht. Letztendlich bedeutet das, dass der Großteil der geschlechtersensiblen Medizin eine Sex-bezogene und nicht eine Gender-bezogene Medizin ist. Die Versorgung von Transgender-Personen fällt nicht in das Spektrum der Gendermedizin. Jedoch wird es häufig so verstanden. Und obwohl es extrem wichtig ist, ist es eine andere Gruppe von Kollegen*innen, die sich damit befasst. Derartige Umschulungen basieren auf freiwilliger Basis.
Gibt es rechtliche Vorgaben?
Seit 2015 gibt es ein Präventionsgesetz, das auf die Notwendigkeit einer geschlechtersensiblen Medizin hinweist und auch darauf, dass die Kostenträger diese vergüten sollten. Es gäbe einen rechtlichen Rahmen dafür und jetzt geht es darum, wie man diesen pragmatisch ausfüllen kann. Die Kostenträger und die Politik sind in gewissem Maße daran interessiert und würden es ohne große Resistenz befürworten. Das Problem ist nur, dass wir dazu natürlich ein Konzept vorlegen müssen. Und da scheiden sich die Geister momentan noch. Das hat mit ganz vielen verschiedenen Ebenen zu tun. Es ist nicht nur eine Kultur- oder Systemveränderung, sondern eine Organisationsveränderung. Einerseits haben wir nicht all das Wissen, was wir bräuchten, um wirklich alle therapeutischen Leitlinien geschlechtersensibel zu entwickeln, weil die Daten zum Teil noch nicht ausreichend vorliegen. Auf der anderen Seite gibt es nur bedingt Finanzierung um große Studien geschlechtsspezifisch anzulegen um diese Daten zu erarbeiten.
Warum ist der Begriff Gender Medizin unpassend?
Es ist auch ein sprachliches Problem: Ich rede bewusst von geschlechtersensibler Medizin, weil das Thema Gender Medizin oft falsch verstanden wird. Es geht ja nicht nur um Gender. Zumindest in der Arbeit, die wir machen, und in der Medizin insgesamt geht es zu 80 bis 90 Prozent um das biologische Geschlecht. Letztendlich bedeutet das, dass der Großteil der geschlechtersensiblen Medizin eine Sex-bezogene und nicht eine Gender-bezogene Medizin ist. Die Versorgung von Transgender-Personen fällt nicht in das Spektrum der Gendermedizin. Jedoch wird es häufig so verstanden. Und obwohl es extrem wichtig ist, ist es eine andere Gruppe von Kollegen*innen, die sich damit befasst.
Wie groß ist die Akzeptanz der GSM unter bereits etablierten Medizinern?
Die Akzeptanz hat sich in den letzten fünf Jahren enorm gesteigert. Das liegt zum einen an dem Generationenwechsel, an mehr Bewusstsein dafür, was die Disziplin für sich anbieten kann. Und zum anderen bedarf es der Pflicht durch die Forschungsförderer, das Thema mit einzubeziehen. Die Europäische Kommission und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fordern mittlerweile, dass alle Geschlechter berücksichtigt werden sollen. Und falls man das nicht macht, muss man angeben warum. Es ist traurig, dass zunächst eine Verpflichtung von Seiten der Forschungsförderer notwendig war. Aber dies war letztendlich die wirksamste Intervention, um die Akzeptanz der geschlechtersensiblen Medizin binnen kurzer Zeit zu steigern.
Was ist die größte Herausforderung einer Durchsetzung der GSM?
Die größte Herausforderung ist den Praxisbezug und was es eigentlich bedeutet geschlechtersensible Medizin zu machen herauszukristallisieren und anschließend dieses Wissen flächendeckend zu implementieren.
Was wäre ein möglicher Lösungsschritt zur Überwindung dieser Hürden?
Wir brauchen klare Konzepte zur Implementierung. Das was aus unseren Reihen immer gefordert wird ist, dass die geschlechtersensible Medizin in die Leitlinien aufgenommen werden muss. Dazu fehlen aber bislang zum Teil Daten für die in der Medizin geforderte standardmäßige Evidenz. Das bedeutet einerseits, dass wir große Studien aktuell und in Zukunft immer geschlechtersensibel anlegen sollten um die Daten zu erheben, und dass wir innovative Ansätze brauchen um diese Daten soweit möglich bereits aus der aktuellen Praxis zu erheben.
.
